Die 3 Quellen echten Lebensglücks: Was wirklich wichtig ist für ein erfülltes Leben, Einfach glücklich sein: Sieben Schlüssel zur Leichtigkeit des Seins, Das Glück in diesem Leben, Der Weg zum Glück, Glücklicher als Gott: Verwandle dein Leben in eine außergewöhnliche Erfahrung. Von der wohligen Atmosphäre abgesehen, frequentiere ich die hiesigen Buchhandlungen mithin aus Interesse daran, dem aktuellen state of mind unserer Gesellschaft gegenwärtig zu sein. Betrachtet man die verfügbaren Bücher immer auch als literarische Manifestation dieses state of mind, so scheinen die erwähnten Buchtitel ein sprechender Ausdruck dafür zu sein, dass wir in einer Zeit des Glücks leben. Freilich bedeutet dies nicht, dass wir eine rundum glückliche Gesellschaft sind. Wäre dem nämlich so, bedürften wir überhaupt keiner Glücksratgeber. So ist es gerade die bemerkenswerte Fülle solcher Bücher, deren Dasein die offenbare Glücksbedürftigkeit ihrer Klientel bezeigt.
Dabei scheint mir auf den schillernden Begriff des Glücks genau das zuzutreffen, was Günter Abel in Bezug auf die Zeit schrieb: „Jeder weiß doch irgendwie, was sie ist; doch sollen wir dies ausbuchstabieren, scheint es, als wissen wir die Antwort nicht mehr.“ (Abel 2008, S.16) Fürwahr nimmt sich „Glück“ als ein solcher Grundbegriff aus, dessen genaue Definierung uns vor notorische Schwierigkeiten stellt, obwohl (oder gerade weil) wir ihn immer schon im Munde tragen. Dieser philosophischen Problemlage versuche ich im Folgenden durch eine Differenzierung zweier verschiedener Glücksbegriffe beizukommen.
(1) Glück als kumulative Euphorie: Dieser Begriffsfassung zufolge besteht Glück in einem freudigen Gemütszustand, einem angenehmen Vergnügen oder einem hochgestimmten Lebensgefühl. Einerseits besticht solches Glück durch seine lustvolle Intensität, welche andererseits den flüchtigen Augenblick nicht überlebt: es sind ephemere Glücksmomente. Dabei wissen wir aus eigener Erfahrung, dass solche Glücksmomente uns ob ihrer phänomenalen Qualitäten den unscheinbaren Imperativ zur Wiederholung flüstern, wozu es in unserer Lebenswelt gewiss nicht an Gelegenheiten mangelt. Diese nämlich kann mit einer verlockenden Vielfalt verschiedenster Euphoriespender aufwarten, deren Entsagung selbst dem gleichmütigsten Stoiker eine Herausforderung wäre: dauerverfügbare Rauschmittel, ungezwungener Geschlechtsverkehr in allen erdenklichen Perversionen, algorithmisch personalisierte Unterhaltung per Wischbewegung – um nur drei zu nennen. Was sich für die einen wie ein weiterer Beleg für die regelmäßig beschworene Dekadenz des Abendlandes liest, ist für die anderen ein Rezept für eine gelungene Partynacht in Berlin.
Um diesen Punkt zu amplifizieren, möchte ich den Song Ariane von K.I.Z als Veranschaulichung anführen. Ohne allzu viel vorwegnehmen zu wollen: Ariane thematisiert den insbesondere für Großstädte typischen Turnus von sklavischer Servilität gegenüber dem Dienstherrn und eskapistischen Exzesspartys am Wochenende. In drei Parts werden Szenen von aufgenötigtem Drogenkonsum, selbstsüchtiger Erpressung, perversen Machtspielchen, gewissenlosen Vergewaltigungsmorden und sexueller Demütigung geschildert. Die Pointe des Songs besteht jedoch in dem durch die Hook hergestellten Kontrast, wenn sich der entmenschte Wochenenddespot zum arbeitswilligen Bückling verwandelt:
Natürlich sind die in Ariane geschilderten Begebenheiten Extrembeispiele und haben als solche vergleichsweise wenig mit den alltäglichen Glücksbemühungen des Durchschnittsbürgers zu tun. Es liegen jedoch interessante Analogien vor:
Gleich den Protagonisten in Ariane trachten auch diejenigen unter uns, welche dem obigen Glücksbegriff anhängen, fortwährend nach Gelegenheiten, ihre Lust durch die stumpfe Verkettung von Vergnügungen zu maximieren, wiewohl diese für gewöhnlich nichts mit Mord oder Vergewaltigung zu tun haben, sondern ungleich harmloser sind.
Eine weitere Ähnlichkeit tritt zutage, wenn wir den Zeitraum von einer Woche auf ein ganzes Jahr ausdehnen und anstelle des zweitägigen Wochenendes einen dreiwöchigen Urlaub setzen. In beiden Fällen wird die arbeitsfreie Zeit als langersehntes Intermezzo verhimmelt, an welches die praktisch unerfüllbare Erwartung gestellt wird, die im Dienst ertragenen Kränkungen zu tilgen und der farblosen Unbehaglichkeit der täglichen Betriebsamkeit ein lebensfrohes Kolorit entgegenzusetzen. Nicht selten manifestieren sich diese überzogenen Erwartungshaltungen im gleichermaßen belächelns- wie bemitleidenswerten Versuch zur minutiösen Durchplanung des Urlaubs, auf dass das Glück in geballter Form über einen hereinbricht. Dabei ignoriert das „Da muss alles passen!“ als imperativer Ausdruck der unverhandelbaren Perfektionsforderung selbst die Launen der Natur, wenn auf eine derartig obskure Dauerverfügbarkeit der Umwelt insistiert wird, dass manche Safaritouren in Nordindien tatsächlich sogenannte „Tigergarantien“ anbieten. Ja, womöglich besteht sogar eine direkte Proportionalität zwischen der Unzufriedenheit im Job und den perfektionistischen Ansprüchen an den Urlaub.
So besehen erhält die Vorstellung vom Glück als eine bloße Akkumulation euphorischer Momente einen bitteren Beigeschmack. Kaum jemand wird sich dazu durchringen können, eine Person, welche den überwiegenden Teil ihrer Zeit mit der Verrichtung von entfremdenden Routinetätigkeiten und der Vorspiegelung von Arbeitswilligkeit zubringt, um daraufhin ihrem grauen Trott mit willenlosen Feierexzessen oder dem perfekten 3-Wochen-Urlaub zu entgegnen, glücklich zu nennen. Und dennoch ist diese Person gemäß dem zugrundeliegenden Begriff ein Verwandter des Sisyphos: Wir müssen sie uns als glücklichen Menschen vorstellen.
(2) Glück im Sinne eines gelingenden Lebens: Dieser Begriffsfassung zufolge besteht Glück in einer das gesamte Leben betreffenden Grundbefindlichkeit, die sich durch eine subjektiv gefühlte Erfüllung auszeichnet. Im Zentrum dieser Begriffsbestimmung steht die altphilosophische Grundfrage nach dem guten Leben.
Eine bildliche Veranschaulichung dieses Glücksbegriffs bietet das Mosaik, dessen einzelne Teile als Metapher für die jeweiligen Komponenten eines erfüllenden Menschenlebens stehen. Im Gegensatz zum vorigen Begriff wird hier das Glück als Resultat einer harmonischen Zusammenfügung der einzelnen Elemente zu einem stimmigen Gesamtbild aufgefasst. Persönliche Beziehungen, Sinnhaftigkeit, Erfolg, Lust, Arbeit, Leidenschaft, Bildung, Sport, Muße und weitere Elemente, die ein gutes Leben ausmachen könnten, sollen in das richtige Verhältnis zueinander gebracht werden, anstatt auf eine desparate Aufwiegung des einen durch das andere zu setzen.
In scharfem Kontrast zur gegenwärtigen Bequemlichkeitstendenz unserer Gesellschaft favorisiert dieser Begriff eine Auffassung von Glück, die in engem Zusammenhang mit Anstrengung, Entbehrung und Schmerz steht. Demnach stellt sich das erstrebenswerte Glück nicht schon mit der vollständigen Befriedigung jeglicher konsumtiven Bedürfnisse ein. Es zehrt vielmehr davon, dass es unsere körperlich-geistigen Kräfte beansprucht und eine aktive Überwindung des Unangenehmen voraussetzt – Sich regen, bringt Segen. Dieses essenzielle Bedingungsverhältnis zwischen Aufwand und Glück wurde bereits vom antiken Tragödiendichter Sophokles eingesehen, wenn er pointiert feststellt: „Was man mühelos erreicht, ist nicht der Mühe wert, erreicht zu werden.“ Ein Memento für die Gegenwart.
Dass unser historisch einmaliger Wohlstand uns trotz der allgegenwärtigen Möglichkeit zur instantanen Bedürfnisbefriedigung nicht zwangsläufig ein glückliches Leben beschert, mag zwar wahrlich keine überraschende Wendung, doch eine bedenkenswerte Einsicht sein. Im Allgemeinen scheint die Vorstellung von Glück als ein Zustand billiger Befriedigung den Unterschied zwischen Gewinn und Verdienst zu verkennen, welchen Kant in §65 seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht am Beispiel des Vergnügens illustriert:
Vergnügen, was man selbst (…) erwirbt, wird verdoppelt gefühlt; einmal als Gewinn und dann noch obenein als Verdienst (die innere Zurechnung, selbst Urheber desselben zu sein). Erarbeitetes Geld vergnügt, wenigstens dauerhafter als im Glücksspiel gewonnenes, und wenn man auch über das Allgemeinschädliche der Lotterie wegsieht, so liegt doch im Gewinn durch dieselbe etwas, dessen sich ein wohldenkender Mensch schämen muß. (Kant: Anth, AA 7:238)
Ohne eine vulgäre „Du-bist-deines-Glückes-Schmied“-Philosophie zu vertreten, welche an der konsequenten Ausblendung der gesellschaftspolitischen Vorbedingungen des Glücklichseins krankt, scheint „Verdienst“ im kantischen Sinne doch der richtige Begriff zu sein, um die elementare Rolle der aktiven Erarbeitung des eigenen Glücks hervorzuheben. Dem folgend könnte man zum Schluss gelangen, dass uns die routinemäßige kommode Lieferandobestellung („Einfach und bequem bestellen!“) während der allabendlichen Netflixsession („Filme und Serien jederzeit und überall genießen. See what’s next.“) gerade deswegen kein anhaltendes Glück verschafft, weil es ein (zu) einfacher Genuss ohne jeden Mehrwert ist.
Dabei ist der zweite Glücksbegriff keineswegs gegen den sinnlichen Genuss per se gerichtet. Durchaus wird das dionysische Moment als unabkömmliche Komponente des glücklichen Lebens geschätzt. Dennoch optiert diese Begriffsfassung für eine holistische Auffassung des Glücks, welche der Lust insofern einen wesentlichen Platz einräumt, dass ihre ebenmäßige Einfügung in das Lebensmosaik zur Gesamtstimmigkeit desselben beiträgt. Um mit einer Metapher Feuerbachs zu schließen: „Das Leben muss wie ein kostbarer Wein mit gehörigen Unterbrechungen Schluck für Schluck genossen werden. Auch der beste Wein verliert für uns allen Reiz, wenn wir ihn wie Wasser hinunterschütten.“ (Feuerbach 1834)
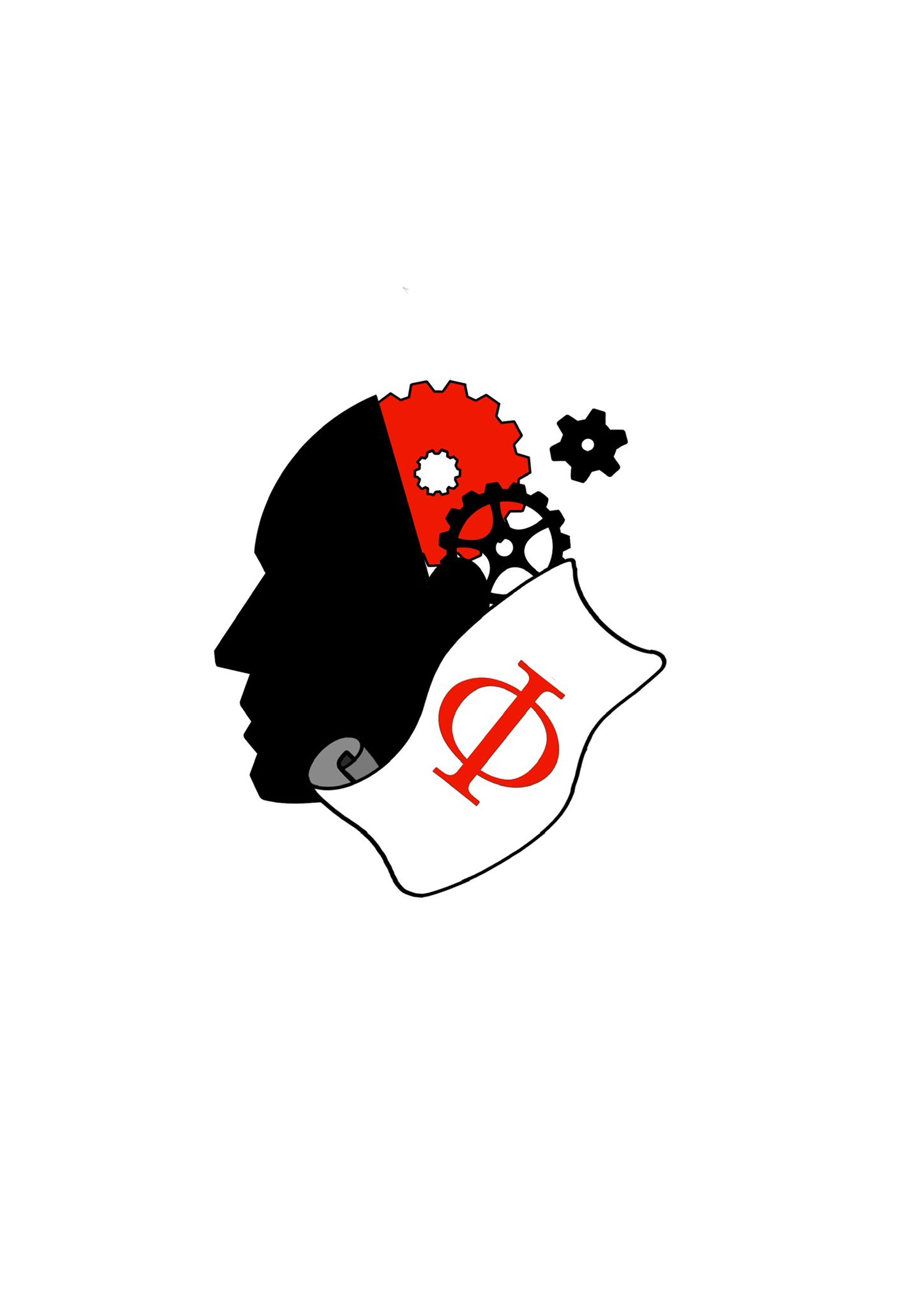
Hinterlasse einen Kommentar